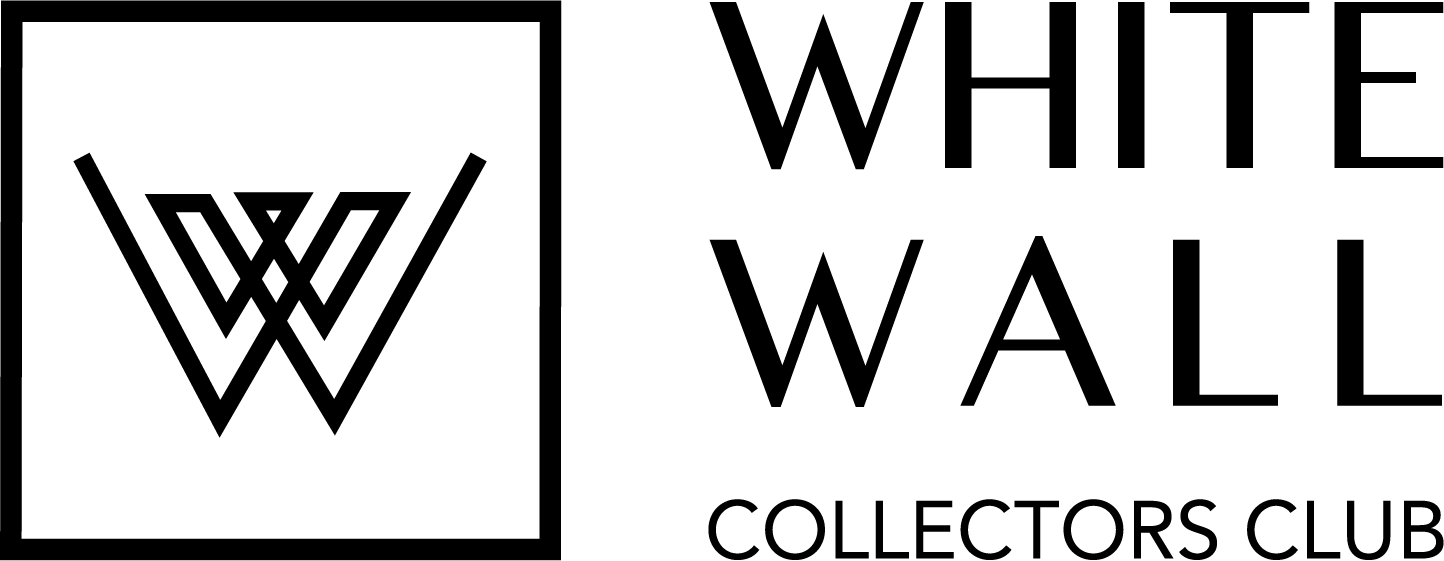Anna Paul

Die Arbeit von Anna Paul (*1987) folgt dem Interesse an den Begebenheiten der Welt und untersucht die Beziehung von Gesellschaft zu Produkten und der (gebauten) Umwelt. Dabei entstehen Skulpturen und Plastiken: Werke in Serie, Objekte oder spezifische räumliche Situationen bzw. sozial-partizipative Environments, die dichte Bezüge zum Architektur- und Designdiskurs aufweisen bzw. sich mit Alltagsritualen beschäftigen. Ausgehend von Grundbedürfnissen, sei es das Spielen, die persönliche Hygiene, das Kochen oder Heilung, legen ihre objektbezogenen Interventionen an öffentlichen Orten, performative Prozesse offen und schaffen damit Sensibilisierung für alltägliche Dinge.
Es gibt ganz viel unausgeschöpftes kreatives Potenzial
Anna Paul
Interview
von Lisa Hollogschwantner
Wie würdest du dich selbst vorstellen?
Wo fange ich da an… Mein Name ist Anna Paul. Ich komme eigentlich nicht aus der Kunst, sondern aus der Architektur. Architektur und Design informieren meine Arbeit stark. Das meint den Gebrauch von Objekten und deren Umfeld. Es geht mir darum, die Produktwelt zu reflektieren, denn für mich lässt sich durch kaum etwas ein so realistisches Bild unserer Gesellschaft zeichnen, wie durch Produkte, die industriell hergestellt werden – überhaupt Produktion fasziniert mich.
Du sprichst von „Dingen, die gebraucht werden können“. Wie viel Funktion verträgt die Kunst?
Vor kurzem hat mich ein Student gefragt, warum ich als Kunstschaffende arbeite und nicht im Industriedesign. Da geht es für mich im Kern um deine Frage: Im Design müssen Dinge vermarktbar und unmittelbar verwertbar sein. Produkte muss verstanden werden, weil niemand ein Produkt kauft, das er nicht versteht. In der Kunst können auch Leerstellen bleiben, es muss nicht alles klar sein, vielmehr umgekehrt. Man kann Dinge auch zu Tode reden. Darin liegt für mich einer der großen Unterschiede. Die Funktion in der Kunst schafft Zugänglichkeit, das finde ich interessant.
Ist jede:r kreativ?
Es gibt Leute, die haben Ideen und es gibt Leute, die haben keine. Der Anteil letzterer ist aber ungleich geringer – ich bin überzeugt, dass fast jede:r kreativ ist, dazu muss man auch nicht als Künstler:in oder in einer krestiven Disziplin arbeiten. Wenn man dann zu den Leuten zählt , die Ideen haben, braucht es zusätzlich das Privileg, diese Ideen auch umsetzen zu können – und dann das tatsächliche Können im Sinne eines Handwerks. Grundsätzlich glaube ich, dass es sehr wenig unkreative Leute gibt, aber ganz viel unausgeschöpftes Potenzial auf Grund von Rahmenbedingungen, die kein kreatives Arbeiten zulassen. Das hat auch mit Klasse zu tun.
Welche Werke zeigst du in Salzburg?
Einerseits Sitzmöbel aus meiner Arbeit „On Bathing Culture“, die Teil einer performativen Installation waren. Konkret handelte es sich dabei um ein Dampfbad, das ich an unterschiedlichen Orten in Wien betrieb. Es durfte gratis genutzt werden und war ein nasser sozialer Raum sozusagen. Im Arbeitsprozess entstanden dann meine Zigaretten aus Poolnudeln der Reihe „No Smoking“, die im Shop zu finden sein werden. Außerdem zeige ich die Arbeit „Just In Time“ in Salzburg, das sich mit dem Konzept der bedarfsynchronen Produktion auseinandersetzt und grundsätzlich mit betrieblichen Prozessen arbeitet. Ich wollte einen Fehler in Serie produzieren, indem ich diese Prozesse manipuliere. Eines der Anliegen dabei war auch den Druck der durch Akkord entsteht zu mindern – durch die Gewissheit, dass nichts falsch laufen kann, weil alles falsch laufen soll. So haben wir dann tatsächlich diese Fehler in Serie produziert.
„Es kann nichts falsch laufen, weil alles falsch laufen soll.“, diesen Gedanken finde ich sehr spannend. Wie wichtig sind Fehler für die Kunst?
Dieser Frage liegt für mich erstmal eine andere zu Grunde: Wie frei kann man als Künstler:in überhaupt arbeiten? Gerade wenn man einen konkreten Auftrag hat, vielleicht auch nur einen Job und nicht mehrere Projekte zeitgleich, dann kann das durchaus einen Druck auslösen – und mit Druck funktioniert in der Kunst sehr, sehr wenig. Es ist meiner Meinung nach sehr wichtig, scheitern zu dürfen, weil darin die größte Chance zu lernen liegt.
Werke